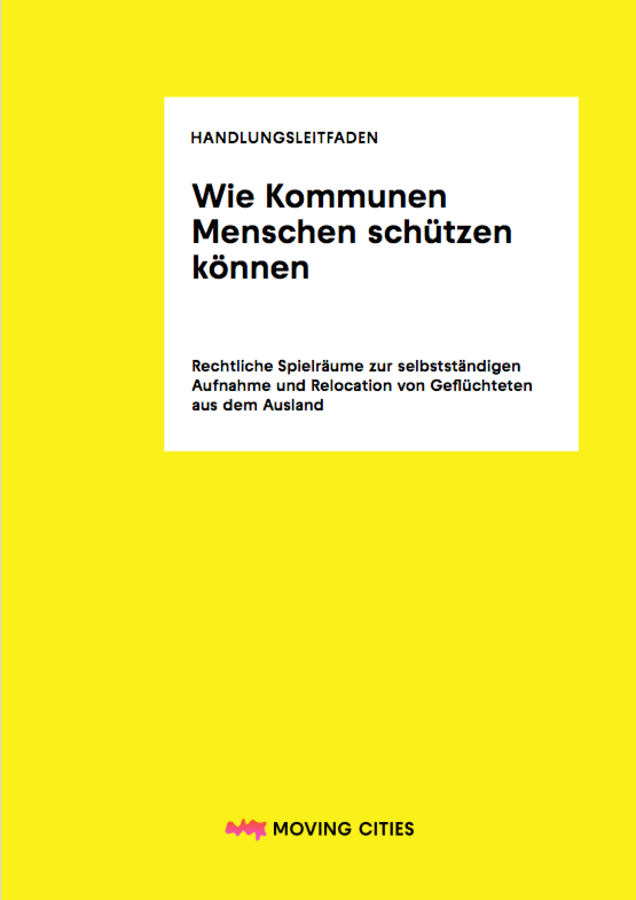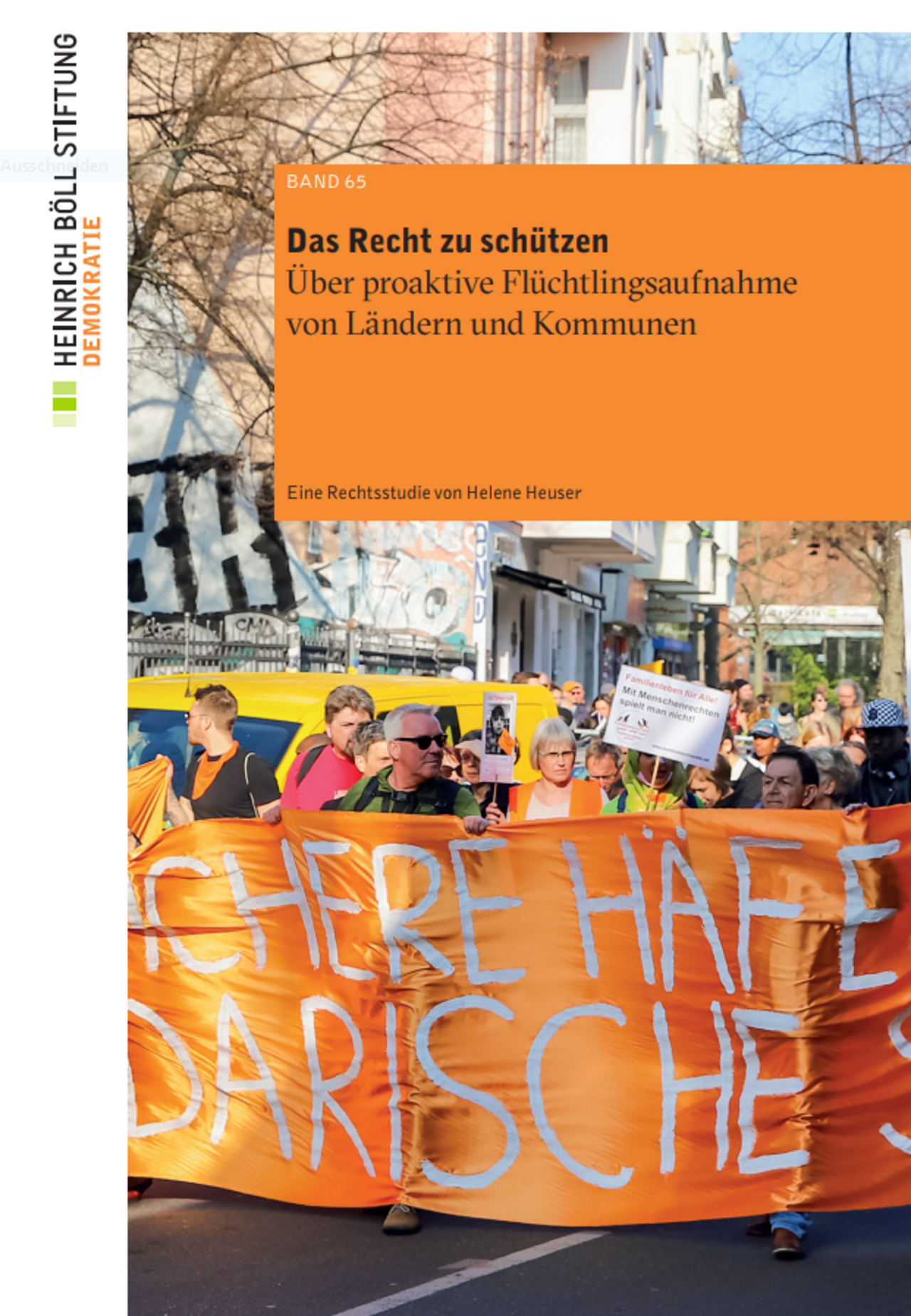Leitfaden: Wie Kommunen Menschen schützen können
Tausende Menschen verlieren jährlich auf der Flucht nach Europa ihr Leben. Um dieser humanitären Katastrophe ein Ende zu bereiten, haben sich in den letzten Jahren in Deutschland über 300 Kommunen öffentlich zu „Sicheren Häfen” erklärt und damit ihre Bereitschaft signalisiert, aus Seenot Gerettete oder Gestrandete aus Flüchtlingslagern wie Moria bei sich vor Ort aufzunehmen. Doch welchen rechtlichen Spielraum haben Kommunen in Deutschland, selbst aktiv zu werden?
Diese Frage beantwortet der Moving Cities Handlungsleitfaden und stellt 20 konkrete Möglichkeiten vor, wie solidarische Städte zur Aufnahme und Relocation von Geflüchteten aus dem Ausland beitragen können.
Für gratis Exemplare oder die Anfrage nach einem kostenfreien Workshop zum Leitfaden für Ihre Kommune, kontaktieren Sie bitte: info@moving-cities.eu
Moving Cities ein Projekt des Vereins United4Rescue - Gemeinsam Retten und wird von der Robert Bosch Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. Umgesetzt wird das Projekt vom Moving Cities Team.
Über proaktive Flüchtlingsaufnahme von Ländern und Kommunen
Jedes Jahr sterben Tausende Menschen im Mittelmeer bei dem Versuch, Schutz und Arbeit in Europa zu finden. Somit ist die südliche europäische Außengrenze die tödlichste Grenze der Welt. Zivilgesellschaftliche Rettungsaktionen und Initiativen wie Solidarity City oder „From the Sea to the City“ sind eine Reaktion auf das Massensterben im Mittelmeer. Freiwillige Aufnahmeprogramme der Kommunen könnten in diesem Zusammenhang die staatlichen und europäischen Verteilungsmechanismen ergänzen. Auf Beteiligung und Freiwilligkeit basierte Maßnahmen würden dazu beitragen, einerseits die Verantwortung auf mehrere Schultern aufzuteilen und andererseits eine solidarische Verteilung innerhalb europäischer Städte und Kommunen zu erzielen.
Politiker*innen im Gespräch
Eine vielfältige Migrationsgesellschaft braucht vielfältige Repräsentation. Doch die gesellschaftliche Vielfalt wird in deutschen Parlamenten weiterhin zu wenig abgebildet, das zeigen auch die Ergebnisse unserer Vielfaltsstudie. Der Schwerpunkt präsentiert unterschiedliche Portraitreihen mit Politiker*innen auf der Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene und bietet Hintergrundinformationen zu den Themen politische Teilhabe und Repräsentation.